Die 15 wichtigsten Meilensteine
Als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland gilt der 12. November 1918, als der Rat der Volksbeauftragten allen Personen ab 20 Jahren das aktive und passive Wahlrecht zuerkannte und damit eine der Hauptforderungen der Frauenbewegung erfüllt war. Hundert Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, das ist ein Grund zu feiern!
„Das Wahlrecht für Frauen war ein entscheidender Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. […] wer nicht wählen darf, hat keine politische Stimme, und wer keine politische Stimme hat, kann sein Anliegen nicht durchsetzen.“
Marie Stritt: Frauenwahlrecht in Deutschland. In: Die Staatsbürgerin 7 (1918) 9, S. 72.

1918 Frauen erhalten das aktive und passive Wahlrecht
1918
Frauen erhalten das aktive und passive Wahlrecht
Als im November 1918 die Weimarer Republik ausgerufen wurde, stellte der Rat der Volksbeauftragten in seinem Aufruf ‚An das deutsche Volk‘ sein Regierungsprogramm vor. Dieser 12. November 1918 gilt als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland, weil die provisorische Regierung eine große Wahlrechtsreform verkündete, die auch das Frauenwahlrecht enthielt. Darin hieß es: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“
Marie Stritt (1855–1928), eine der Wegbereiterinnen des Frauenwahlrechts, vertrat 1918 die Ansicht: „Die deutschen Frauen haben das Wahlrecht. […] Es ist eine übergangslose Erhebung aus gänzlicher politischer Rechtlosigkeit zu voller staatsbürgerlicher Freiheit, [ …] etwas wie ein Wunder […].“
Das Reichswahlgesetz trat am 30. November 1918 in Kraft und so waren die Wahlen am 19. Januar 1919 zur Weimarer Nationalversammlung die ersten, an denen sich Frauen beteiligen konnten. 17,7 Millionen Bürgerinnen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ihre Wahlbeteiligung lag damit bei 82,3 Prozent.
Zum ersten Mal konnten Frauen auch gewählt werden. Obwohl 54 Prozent der Wahlberechtigten Frauen waren, standen nur 308 Frauen und 1310 Männer zur Wahl. Unter den 423 gewählten Abgeordneten waren dann 8,5 Prozent Frauen. 17 Politikerinnen gehörten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) an, sechs der Deutschen Zentrumspartei (Zentrum), fünf der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), jeweils drei der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) bzw. der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) und eine der Deutschen Volkspartei (DVP). Im Verlauf der Legislaturperiode rückten weitere fünf Frauen nach.
Diese Parlamentarierinnen der ersten Stunde waren keine erfahrenen Berufspolitikerinnen. Sie mussten sich innerhalb der Reichsgremien erst einmal zu behaupten lernen, zumal ihnen einzelne Männer den Einstieg schwer machten und sie nicht ernst nahmen.
Aber die Chance war da, die Parlamentarierinnen konnten nun auch Themen einbringen, die besonders die Lebenssituation und die Interessen von Frauen betrafen. Viele dieser Themen sind noch heute aktuell, z.B. die Lohnungleichheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1918 Frauen erhalten das aktive und passive Wahlrecht
1918
Frauen erhalten das aktive und passive Wahlrecht
Als im November 1918 die Weimarer Republik ausgerufen wurde, stellte der Rat der Volksbeauftragten in seinem Aufruf ‚An das deutsche Volk‘ sein Regierungsprogramm vor. Dieser 12. November 1918 gilt als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland, weil die provisorische Regierung eine große Wahlrechtsreform verkündete, die auch das Frauenwahlrecht enthielt. Darin hieß es: „Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.“
Marie Stritt (1855–1928), eine der Wegbereiterinnen des Frauenwahlrechts, vertrat 1918 die Ansicht: „Die deutschen Frauen haben das Wahlrecht. […] Es ist eine übergangslose Erhebung aus gänzlicher politischer Rechtlosigkeit zu voller staatsbürgerlicher Freiheit, [ …] etwas wie ein Wunder […].“
Das Reichswahlgesetz trat am 30. November 1918 in Kraft und so waren die Wahlen am 19. Januar 1919 zur Weimarer Nationalversammlung die ersten, an denen sich Frauen beteiligen konnten. 17,7 Millionen Bürgerinnen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ihre Wahlbeteiligung lag damit bei 82,3 Prozent.
Zum ersten Mal konnten Frauen auch gewählt werden. Obwohl 54 Prozent der Wahlberechtigten Frauen waren, standen nur 308 Frauen und 1310 Männer zur Wahl. Unter den 423 gewählten Abgeordneten waren dann 8,5 Prozent Frauen. 17 Politikerinnen gehörten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) an, sechs der Deutschen Zentrumspartei (Zentrum), fünf der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), jeweils drei der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) bzw. der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) und eine der Deutschen Volkspartei (DVP). Im Verlauf der Legislaturperiode rückten weitere fünf Frauen nach.
Diese Parlamentarierinnen der ersten Stunde waren keine erfahrenen Berufspolitikerinnen. Sie mussten sich innerhalb der Reichsgremien erst einmal zu behaupten lernen, zumal ihnen einzelne Männer den Einstieg schwer machten und sie nicht ernst nahmen.
Aber die Chance war da, die Parlamentarierinnen konnten nun auch Themen einbringen, die besonders die Lebenssituation und die Interessen von Frauen betrafen. Viele dieser Themen sind noch heute aktuell, z.B. die Lohnungleichheit oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1919 Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
1919
Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
Die SPD-Politikerin Marie Juchacz (1879–1956) war eine der Frauen, die im Januar 1919 in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Am elften Sitzungstag des neugewählten Parlaments, am 19. Februar 1919, sprach sie dort als erste Parlamentarierin überhaupt. Sie wurde vom Präsidenten der Weimarer Nationalversammlung ganz sachlich und ohne einen Hinweis auf den besonderen historischen Augenblick mit den Worten angekündigt: „Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz.“
Die Rede von Marie Juchacz dauerte vier Minuten und begann mit den Worten „Meine Herren und Damen!“. Laut Protokoll rief die Rednerin damit große Heiterkeit hervor. Sie betonte dann auch: „Es ist das erstemal, daß in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“. Außerdem stellte die Rednerin klar: „Ich möchte hier feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, daß wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Marie Juchacz ging unter anderem auf die kommenden Aufgaben der Politiker und Politikerinnen und die Situation in Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg ein. Ihre Rede wurde von Gelächter und Protestrufen konservativer männlicher Parlamentarier begleitet. Am selben Tag sprachen auch Helene Weber (1881–1962) über die Auswirkungen des Friedensvertrags und Luise Schroeder (1887–1957) über den Reichshaushaltsplan, Marie Lüders (1878–1966) prangerte die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts im Betriebsrätesystem an.
Die in Landsberg an der Warthe aufgewachsene Marie Juchacz ließ sich, was damals noch ungewöhnlich war, von ihrem Mann scheiden und zog 1905 mit zwei kleinen Kindern nach Berlin. Dort trat sie 1908 in die SPD ein. Später wurde sie Mitglied des Parteivorstands und Leiterin des Frauensekretariats. Außerdem übernahm die Politikerin die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit – Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Sie gehörte als einzige Frau dem „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs“ der Nationalversammlung an. Als Abgeordnete widmete sie sich hauptsächlich der Sozialpolitik. Sie trat unter anderem für einen besseren Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Jugendhilfe und eine Änderung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder ein. Als ihre größte sozialpolitische Leistung wird die Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dezember 1919 gewertet, als dessen erste Vorsitzende sie bis 1933 tätig war.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte Marie Juchacz, zunächst ins Saargebiet, dann ins Elsass, 1941 nach New York. 1949 kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde Ehrenvorsitzende der AWO. Sie starb im Alter von 76 Jahren.

1919 Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
1919
Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
Die SPD-Politikerin Marie Juchacz (1879–1956) war eine der Frauen, die im Januar 1919 in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Am elften Sitzungstag des neugewählten Parlaments, am 19. Februar 1919, sprach sie dort als erste Parlamentarierin überhaupt. Sie wurde vom Präsidenten der Weimarer Nationalversammlung ganz sachlich und ohne einen Hinweis auf den besonderen historischen Augenblick mit den Worten angekündigt: „Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz.“
Die Rede von Marie Juchacz dauerte vier Minuten und begann mit den Worten „Meine Herren und Damen!“. Laut Protokoll rief die Rednerin damit große Heiterkeit hervor. Sie betonte dann auch: „Es ist das erstemal, daß in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“. Außerdem stellte die Rednerin klar: „Ich möchte hier feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, daß wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Marie Juchacz ging unter anderem auf die kommenden Aufgaben der Politiker und Politikerinnen und die Situation in Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg ein. Ihre Rede wurde von Gelächter und Protestrufen konservativer männlicher Parlamentarier begleitet. Am selben Tag sprachen auch Helene Weber (1881–1962) über die Auswirkungen des Friedensvertrags und Luise Schroeder (1887–1957) über den Reichshaushaltsplan, Marie Lüders (1878–1966) prangerte die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts im Betriebsrätesystem an.
Die in Landsberg an der Warthe aufgewachsene Marie Juchacz ließ sich, was damals noch ungewöhnlich war, von ihrem Mann scheiden und zog 1905 mit zwei kleinen Kindern nach Berlin. Dort trat sie 1908 in die SPD ein. Später wurde sie Mitglied des Parteivorstands und Leiterin des Frauensekretariats. Außerdem übernahm die Politikerin die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit – Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Sie gehörte als einzige Frau dem „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs“ der Nationalversammlung an. Als Abgeordnete widmete sie sich hauptsächlich der Sozialpolitik. Sie trat unter anderem für einen besseren Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Jugendhilfe und eine Änderung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder ein. Als ihre größte sozialpolitische Leistung wird die Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dezember 1919 gewertet, als dessen erste Vorsitzende sie bis 1933 tätig war.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte Marie Juchacz, zunächst ins Saargebiet, dann ins Elsass, 1941 nach New York. 1949 kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde Ehrenvorsitzende der AWO. Sie starb im Alter von 76 Jahren.

1919 Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
1919
Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
Die SPD-Politikerin Marie Juchacz (1879–1956) war eine der Frauen, die im Januar 1919 in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Am elften Sitzungstag des neugewählten Parlaments, am 19. Februar 1919, sprach sie dort als erste Parlamentarierin überhaupt. Sie wurde vom Präsidenten der Weimarer Nationalversammlung ganz sachlich und ohne einen Hinweis auf den besonderen historischen Augenblick mit den Worten angekündigt: „Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz.“
Die Rede von Marie Juchacz dauerte vier Minuten und begann mit den Worten „Meine Herren und Damen!“. Laut Protokoll rief die Rednerin damit große Heiterkeit hervor. Sie betonte dann auch: „Es ist das erstemal, daß in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“. Außerdem stellte die Rednerin klar: „Ich möchte hier feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, daß wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Marie Juchacz ging unter anderem auf die kommenden Aufgaben der Politiker und Politikerinnen und die Situation in Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg ein. Ihre Rede wurde von Gelächter und Protestrufen konservativer männlicher Parlamentarier begleitet. Am selben Tag sprachen auch Helene Weber (1881–1962) über die Auswirkungen des Friedensvertrags und Luise Schroeder (1887–1957) über den Reichshaushaltsplan, Marie Lüders (1878–1966) prangerte die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts im Betriebsrätesystem an.
Die in Landsberg an der Warthe aufgewachsene Marie Juchacz ließ sich, was damals noch ungewöhnlich war, von ihrem Mann scheiden und zog 1905 mit zwei kleinen Kindern nach Berlin. Dort trat sie 1908 in die SPD ein. Später wurde sie Mitglied des Parteivorstands und Leiterin des Frauensekretariats. Außerdem übernahm die Politikerin die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit – Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Sie gehörte als einzige Frau dem „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs“ der Nationalversammlung an. Als Abgeordnete widmete sie sich hauptsächlich der Sozialpolitik. Sie trat unter anderem für einen besseren Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Jugendhilfe und eine Änderung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder ein. Als ihre größte sozialpolitische Leistung wird die Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dezember 1919 gewertet, als dessen erste Vorsitzende sie bis 1933 tätig war.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte Marie Juchacz, zunächst ins Saargebiet, dann ins Elsass, 1941 nach New York. 1949 kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde Ehrenvorsitzende der AWO. Sie starb im Alter von 76 Jahren.
1919 Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
1919
Marie Juchacz – Die erste Rede einer Frau im Reichstag
Die SPD-Politikerin Marie Juchacz (1879–1956) war eine der Frauen, die im Januar 1919 in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurde. Am elften Sitzungstag des neugewählten Parlaments, am 19. Februar 1919, sprach sie dort als erste Parlamentarierin überhaupt. Sie wurde vom Präsidenten der Weimarer Nationalversammlung ganz sachlich und ohne einen Hinweis auf den besonderen historischen Augenblick mit den Worten angekündigt: „Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz.“
Die Rede von Marie Juchacz dauerte vier Minuten und begann mit den Worten „Meine Herren und Damen!“. Laut Protokoll rief die Rednerin damit große Heiterkeit hervor. Sie betonte dann auch: „Es ist das erstemal, daß in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“. Außerdem stellte die Rednerin klar: „Ich möchte hier feststellen und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, daß wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Marie Juchacz ging unter anderem auf die kommenden Aufgaben der Politiker und Politikerinnen und die Situation in Deutschland nach dem verlorenen Weltkrieg ein. Ihre Rede wurde von Gelächter und Protestrufen konservativer männlicher Parlamentarier begleitet. Am selben Tag sprachen auch Helene Weber (1881–1962) über die Auswirkungen des Friedensvertrags und Luise Schroeder (1887–1957) über den Reichshaushaltsplan, Marie Lüders (1878–1966) prangerte die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts im Betriebsrätesystem an.
Die in Landsberg an der Warthe aufgewachsene Marie Juchacz ließ sich, was damals noch ungewöhnlich war, von ihrem Mann scheiden und zog 1905 mit zwei kleinen Kindern nach Berlin. Dort trat sie 1908 in die SPD ein. Später wurde sie Mitglied des Parteivorstands und Leiterin des Frauensekretariats. Außerdem übernahm die Politikerin die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit – Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Sie gehörte als einzige Frau dem „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs“ der Nationalversammlung an. Als Abgeordnete widmete sie sich hauptsächlich der Sozialpolitik. Sie trat unter anderem für einen besseren Mütter- und Wöchnerinnenschutz, für Jugendhilfe und eine Änderung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder ein. Als ihre größte sozialpolitische Leistung wird die Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dezember 1919 gewertet, als dessen erste Vorsitzende sie bis 1933 tätig war.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte Marie Juchacz, zunächst ins Saargebiet, dann ins Elsass, 1941 nach New York. 1949 kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde Ehrenvorsitzende der AWO. Sie starb im Alter von 76 Jahren.

1933 Frauen wird das passive Wahlrecht abgesprochen
1933
Frauen wird das passive Wahlrecht abgesprochen
Unter den Nationalsozialisten wurde das gerade erst Erreichte wieder rückgängig gemacht! Adolf Hitlers berühmte Formulierung hierzu lautet: „Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein.“
Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung legte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) fest, dass Frauen weder in die Parteiführung noch in deren leitenden Ausschuss aufgenommen werden konnten. Nach ihrem Machtantritt verabschiedete die NSDAP Gesetze, die Frauen aus den gehobenen Berufen verdrängten und Tätigkeiten als Hausfrau und Mutter belohnten. Zusätzlich wurden Anreize für das Aufgeben der Erwerbstätigkeit im Falle der Mutterschaft geschaffen. Und den Frauen wurde das passive Wahlrecht aberkannt. Sie durften zwar noch wählen, aber nicht mehr gewählt werden. Das Frauenbild dieser Zeit war beschränkt auf die Rolle als Mutter. Als Pendant zum Eisernen Kreuz für Soldaten wurden kinderreiche Mütter mit dem Ehrenkreuz der Deutschen Mutter als Dank für ihren Einsatz bei der Geburt und der Kinderaufzucht ausgezeichnet. Voraussetzung für die Verleihung war, dass die Mutter „deutschblütig und erbtüchtig“ war und die Kinder lebend geboren wurden.
Berufs- und Bildungschancen für Frauen wurden im Nationalsozialismus massiv eingeschränkt, Entscheidungen waren Männern vorbehalten. Hitlers Ideologie sah vor, dass die persönliche Freiheit hinter die Pflicht zur Erhaltung der Rasse zurücktritt. Konfessionelle und nicht konfessionelle Frauenverbände wurden verboten oder kamen durch Auflösung dem Verbot zuvor. Entsprechend den Jugendorganisationen gab es nur noch gleichgeschaltete Frauenorganisationen: das Deutsche Frauenwerk und die NS-Frauenschaft.
Außer dem passiven Wahlrecht verloren Frauen auch die Berechtigung zur Habilitation und die Erlaubnis, das Richteramt oder den Beruf der Rechtsanwältin auszuüben.
Doch wie auch schon während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) wurde im Nationalsozialismus weibliche Erwerbsarbeit immer wichtiger, da die Männer Militärdienst leisteten und in den Arbeitsprozessen fehlten. So gilt auch für diese Phase, dass der kriegsbedingte Arbeitskräftemangel dazu führte, dass das Berufsverbot für Frauen eingeschränkt wurde.
1933 Frauen wird das passive Wahlrecht abgesprochen
1933
Frauen wird das passive Wahlrecht abgesprochen
Unter den Nationalsozialisten wurde das gerade erst Erreichte wieder rückgängig gemacht! Adolf Hitlers berühmte Formulierung hierzu lautet: „Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein.“
Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung legte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) fest, dass Frauen weder in die Parteiführung noch in deren leitenden Ausschuss aufgenommen werden konnten. Nach ihrem Machtantritt verabschiedete die NSDAP Gesetze, die Frauen aus den gehobenen Berufen verdrängten und Tätigkeiten als Hausfrau und Mutter belohnten. Zusätzlich wurden Anreize für das Aufgeben der Erwerbstätigkeit im Falle der Mutterschaft geschaffen. Und den Frauen wurde das passive Wahlrecht aberkannt. Sie durften zwar noch wählen, aber nicht mehr gewählt werden. Das Frauenbild dieser Zeit war beschränkt auf die Rolle als Mutter. Als Pendant zum Eisernen Kreuz für Soldaten wurden kinderreiche Mütter mit dem Ehrenkreuz der Deutschen Mutter als Dank für ihren Einsatz bei der Geburt und der Kinderaufzucht ausgezeichnet. Voraussetzung für die Verleihung war, dass die Mutter „deutschblütig und erbtüchtig“ war und die Kinder lebend geboren wurden.
Berufs- und Bildungschancen für Frauen wurden im Nationalsozialismus massiv eingeschränkt, Entscheidungen waren Männern vorbehalten. Hitlers Ideologie sah vor, dass die persönliche Freiheit hinter die Pflicht zur Erhaltung der Rasse zurücktritt. Konfessionelle und nicht konfessionelle Frauenverbände wurden verboten oder kamen durch Auflösung dem Verbot zuvor. Entsprechend den Jugendorganisationen gab es nur noch gleichgeschaltete Frauenorganisationen: das Deutsche Frauenwerk und die NS-Frauenschaft.
Außer dem passiven Wahlrecht verloren Frauen auch die Berechtigung zur Habilitation und die Erlaubnis, das Richteramt oder den Beruf der Rechtsanwältin auszuüben.
Doch wie auch schon während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) wurde im Nationalsozialismus weibliche Erwerbsarbeit immer wichtiger, da die Männer Militärdienst leisteten und in den Arbeitsprozessen fehlten. So gilt auch für diese Phase, dass der kriegsbedingte Arbeitskräftemangel dazu führte, dass das Berufsverbot für Frauen eingeschränkt wurde.
1949 Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
1949
Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz (GG), die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren, beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Unter den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des Parlamentarischen Rats waren vier Frauen: Frieda Nadig (1897–1979), Elisabeth Selbert (1896–1986), Helene Weber (1881–1962) und Helene Wessel (1898–1969). Jede der vier Frauen brachte viele Jahre beruflicher und politischer Erfahrung mit. Sie werden als ‚Mütter des Grundgesetzes‘ bezeichnet, denn sie haben wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zu der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen.
Insbesondere für Elisabeth Selbert gehörte die Gleichberechtigung der Geschlechter ganz selbstverständlich zu den Menschenrechten. Sie war es, die den Gleichheitssatz formulierte und sich in zähen Verhandlungen für seine Aufnahme in das Grundgesetz einsetzte. Allerdings scheiterte der Antrag der Sozialdemokraten, dass die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen wurde, zunächst zwei Mal, da er im Parlamentarischen Rat auf heftigen Widerstand stieß. Es sollte die Formulierung der Weimarer Verfassung übernommen werden: „Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Jedoch ließ diese Formulierung zu viele Auslegungen zu, weshalb Frauen aus Frauenverbänden, Gewerkschaften und Parteien und nicht zuletzt durch eine beispiellose Postkartenaktion Elisabeth Selberts dagegen protestierten. Ihr gelang es gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, auch noch die anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu überzeugen. So wurde die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, als Artikel 3, Absatz 2 in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Aber noch blieben alle Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) von 1900 unangetastet. In allen Bereichen besaß allein der Mann die Entscheidungsbefugnis.

1949 Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
1949
Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz (GG), die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren, beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Unter den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des Parlamentarischen Rats waren vier Frauen: Frieda Nadig (1897–1979), Elisabeth Selbert (1896–1986), Helene Weber (1881–1962) und Helene Wessel (1898–1969). Jede der vier Frauen brachte viele Jahre beruflicher und politischer Erfahrung mit. Sie werden als ‚Mütter des Grundgesetzes‘ bezeichnet, denn sie haben wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zu der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen.
Insbesondere für Elisabeth Selbert gehörte die Gleichberechtigung der Geschlechter ganz selbstverständlich zu den Menschenrechten. Sie war es, die den Gleichheitssatz formulierte und sich in zähen Verhandlungen für seine Aufnahme in das Grundgesetz einsetzte. Allerdings scheiterte der Antrag der Sozialdemokraten, dass die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen wurde, zunächst zwei Mal, da er im Parlamentarischen Rat auf heftigen Widerstand stieß. Es sollte die Formulierung der Weimarer Verfassung übernommen werden: „Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Jedoch ließ diese Formulierung zu viele Auslegungen zu, weshalb Frauen aus Frauenverbänden, Gewerkschaften und Parteien und nicht zuletzt durch eine beispiellose Postkartenaktion Elisabeth Selberts dagegen protestierten. Ihr gelang es gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, auch noch die anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu überzeugen. So wurde die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, als Artikel 3, Absatz 2 in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Aber noch blieben alle Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) von 1900 unangetastet. In allen Bereichen besaß allein der Mann die Entscheidungsbefugnis.

1949 Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
1949
Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz (GG), die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren, beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Unter den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des Parlamentarischen Rats waren vier Frauen: Frieda Nadig (1897–1979), Elisabeth Selbert (1896–1986), Helene Weber (1881–1962) und Helene Wessel (1898–1969). Jede der vier Frauen brachte viele Jahre beruflicher und politischer Erfahrung mit. Sie werden als ‚Mütter des Grundgesetzes‘ bezeichnet, denn sie haben wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zu der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen.
Insbesondere für Elisabeth Selbert gehörte die Gleichberechtigung der Geschlechter ganz selbstverständlich zu den Menschenrechten. Sie war es, die den Gleichheitssatz formulierte und sich in zähen Verhandlungen für seine Aufnahme in das Grundgesetz einsetzte. Allerdings scheiterte der Antrag der Sozialdemokraten, dass die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen wurde, zunächst zwei Mal, da er im Parlamentarischen Rat auf heftigen Widerstand stieß. Es sollte die Formulierung der Weimarer Verfassung übernommen werden: „Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Jedoch ließ diese Formulierung zu viele Auslegungen zu, weshalb Frauen aus Frauenverbänden, Gewerkschaften und Parteien und nicht zuletzt durch eine beispiellose Postkartenaktion Elisabeth Selberts dagegen protestierten. Ihr gelang es gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, auch noch die anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu überzeugen. So wurde die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, als Artikel 3, Absatz 2 in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Aber noch blieben alle Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) von 1900 unangetastet. In allen Bereichen besaß allein der Mann die Entscheidungsbefugnis.
1949 Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
1949
Artikel 3, Absatz 2 Grundgesetz (GG)
Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz (GG), die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren, beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Unter den 65 stimmberechtigten Mitgliedern des Parlamentarischen Rats waren vier Frauen: Frieda Nadig (1897–1979), Elisabeth Selbert (1896–1986), Helene Weber (1881–1962) und Helene Wessel (1898–1969). Jede der vier Frauen brachte viele Jahre beruflicher und politischer Erfahrung mit. Sie werden als ‚Mütter des Grundgesetzes‘ bezeichnet, denn sie haben wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zu der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen.
Insbesondere für Elisabeth Selbert gehörte die Gleichberechtigung der Geschlechter ganz selbstverständlich zu den Menschenrechten. Sie war es, die den Gleichheitssatz formulierte und sich in zähen Verhandlungen für seine Aufnahme in das Grundgesetz einsetzte. Allerdings scheiterte der Antrag der Sozialdemokraten, dass die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen wurde, zunächst zwei Mal, da er im Parlamentarischen Rat auf heftigen Widerstand stieß. Es sollte die Formulierung der Weimarer Verfassung übernommen werden: „Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Jedoch ließ diese Formulierung zu viele Auslegungen zu, weshalb Frauen aus Frauenverbänden, Gewerkschaften und Parteien und nicht zuletzt durch eine beispiellose Postkartenaktion Elisabeth Selberts dagegen protestierten. Ihr gelang es gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, auch noch die anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu überzeugen. So wurde die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, als Artikel 3, Absatz 2 in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Aber noch blieben alle Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) von 1900 unangetastet. In allen Bereichen besaß allein der Mann die Entscheidungsbefugnis.

1957 Aufhebung des „Gehorsamsparagraphen“
1957
Aufhebung des „Gehorsamsparagraphen“
Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs, am 1. Januar 1900, war das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft getreten. Seine Regelungen verankerten die Rechtsstellung der Frau ganz im Sinne des Patriarchats. So entschied in Fragen der Haushaltsführung und der Kindererziehung in Streitfällen der Mann. Arbeitsverträge der Frau konnte er auch gegen ihren Willen kündigen. Und hatte die verheiratete Frau eigenes Geld, so konnte allein der Mann darüber verfügen und ihm allein gehörten die Einkünfte aus dem Vermögen der Frau. So war in Paragraph 1354 formuliert: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu.“ Dieser Paragraph wird deshalb als Gehorsamsparagraph bezeichnet.
Die Aufnahme des Gleichberechtigungsgebots (Art.3, Abs.2) ins Grundgesetz 1949 machte allerdings eine Reform notwendig, die insbesondere diesen Paragraphen betraf. Die dafür festgelegte Frist verstrich jedoch zunächst ergebnislos. Der Unterausschuss ‚Familienrechtsgesetz‘ beschäftigte sich von 1955 bis 1957 mit den aufkommenden Fragen und Änderungen. Am 18. Juni 1957 wurde der ‚Gehorsamsparagraph‘ersatzlos gestrichen.
Das Erste Gleichberechtigungsgesetz trat 1958 in Kraft. Im Vorwort zu diesem Gesetz stand noch zu lesen: „Die vornehmste Aufgabe der Frau ist es, das Herz der Familie zu sein.“ Nach wie vor wurde ihr die Verantwortung für den Haushalt übertragen. Paragraph 1356 lautet: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie zu vereinbaren ist.“ Und Paragraph 1360 hält fest: „Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Die Frau erfüllt ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts; zu einer Erwerbsarbeit ist sie nur verpflichtet, soweit die Arbeitskraft des Mannes und die Einkünfte der Ehegatten zum Unterhalt der Familie nicht ausreichen.“
Zu den Errungenschaften dieses Gesetzes zählt, dass Frauen nun ihr Vermögen selbst verwalten durften und auch selbst entscheiden konnten, ob sie berufstätig sein wollten.
1957 Aufhebung des „Gehorsamsparagraphen“
1957
Aufhebung des „Gehorsamsparagraphen“
Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs, am 1. Januar 1900, war das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft getreten. Seine Regelungen verankerten die Rechtsstellung der Frau ganz im Sinne des Patriarchats. So entschied in Fragen der Haushaltsführung und der Kindererziehung in Streitfällen der Mann. Arbeitsverträge der Frau konnte er auch gegen ihren Willen kündigen. Und hatte die verheiratete Frau eigenes Geld, so konnte allein der Mann darüber verfügen und ihm allein gehörten die Einkünfte aus dem Vermögen der Frau. So war in Paragraph 1354 formuliert: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu.“ Dieser Paragraph wird deshalb als Gehorsamsparagraph bezeichnet.
Die Aufnahme des Gleichberechtigungsgebots (Art.3, Abs.2) ins Grundgesetz 1949 machte allerdings eine Reform notwendig, die insbesondere diesen Paragraphen betraf. Die dafür festgelegte Frist verstrich jedoch zunächst ergebnislos. Der Unterausschuss ‚Familienrechtsgesetz‘ beschäftigte sich von 1955 bis 1957 mit den aufkommenden Fragen und Änderungen. Am 18. Juni 1957 wurde der ‚Gehorsamsparagraph‘ersatzlos gestrichen.
Das Erste Gleichberechtigungsgesetz trat 1958 in Kraft. Im Vorwort zu diesem Gesetz stand noch zu lesen: „Die vornehmste Aufgabe der Frau ist es, das Herz der Familie zu sein.“ Nach wie vor wurde ihr die Verantwortung für den Haushalt übertragen. Paragraph 1356 lautet: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie zu vereinbaren ist.“ Und Paragraph 1360 hält fest: „Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Die Frau erfüllt ihre Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts; zu einer Erwerbsarbeit ist sie nur verpflichtet, soweit die Arbeitskraft des Mannes und die Einkünfte der Ehegatten zum Unterhalt der Familie nicht ausreichen.“
Zu den Errungenschaften dieses Gesetzes zählt, dass Frauen nun ihr Vermögen selbst verwalten durften und auch selbst entscheiden konnten, ob sie berufstätig sein wollten.
1961 Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
1961
Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
Als am 14. November 1961 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986) als Bundesministerin für Gesundheitswesen berufen wurde, war es der Initiative von Helene Weber zu verdanken, dass Konrad Adenauer erstmals eine Frau ins Kabinett aufnahm und Elisabeth Schwarzhaupt an die Spitze des neu eingerichteten Ministeriums berief. Die CDU-Politikerin war damit die erste Frau an der Spitze eines Bundesministeriums in Deutschland und erreichte das höchste politische Amt, das eine Frau bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland inne gehabt hat. Sie selbst betrachtete sich jedoch immer als ‚Alibifrau‘.
Elisabeth Schwarzhaupt studierte Jura, promovierte und arbeitete bis 1933 als Richterin. Durch den Nationalsozialismus konnte sie diese Tätigkeit nicht weiter ausüben. Sie setze sich früh mit der Frage auseinander, wie die Rolle der Frau aussehen könnte, um gleichzeitig eine Familie gründen und berufstätig sein zu können. So kam sie auch zur Politik. Sie wollte die zeitgenössische Frauenrolle, auf die häusliche Sphäre reduziert zu sein, nicht übernehmen. Als Juristin spezialisierte sie sich auf das Familienrecht und lernte dieses als ein Recht kennen, das Frauen weitgehend als unmündig behandelte.
1953 trat sie in die CDU ein und kandidierte bei der Wahl zum Zweiten Deutschen Bundestag. Wie auch in den folgenden drei Legislaturperioden zog sie in den Bundestag ein und wirkte an der Reform des Familienrechts mit. Sie setzte sich, auch gegen ihre eigene Partei, für die Streichung des sogenannten ‚Gehorsamsparagraphen‘, für die Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes und für die Reform des Scheidungsrechts ein.
Als erste Ministerin sah sie sich neben den eigentlichen Aufgaben mit zahlreichen Widerständen aus den Reihen ihrer Kabinettskollegen, der eigenen Fraktion und deren Frauengruppe konfrontiert. Neben dem Contergan-Skandal fallen in ihre Amtszeit die Forcierung der Ernährungsberatung sowie die Einführung der Polio-Schluckimpfung und der Krebsvorsorge bei Frauen als Pflichtleistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Doch Elisabeth Schwarzhaupt wurde in ihrem Ressort nicht wirklich heimisch und stellte es 1966 zur Verfügung, um als einfache Abgeordnete in den Bundestag zurückzukehren und sich wieder dem Familienrecht zu widmen. 1969 kandidierte sie nicht mehr für den Bundestag, engagierte sich aber unter anderem im Vorstand des Deutschen Frauenrates, des Evangelischen Frauenbundes, des Deutschen Akademikerinnenbundes und des Deutschen Juristinnenbundes. Bis zu ihrem Tod 1986 nahm Elisabeth Schwarzhaupt immer wieder Stellung zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht und zur Rolle der Frau in einer veränderten Gesellschaft und wollte möglichst viele Frauen politisch mobilisieren.

1961 Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
1961
Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
Als am 14. November 1961 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986) als Bundesministerin für Gesundheitswesen berufen wurde, war es der Initiative von Helene Weber zu verdanken, dass Konrad Adenauer erstmals eine Frau ins Kabinett aufnahm und Elisabeth Schwarzhaupt an die Spitze des neu eingerichteten Ministeriums berief. Die CDU-Politikerin war damit die erste Frau an der Spitze eines Bundesministeriums in Deutschland und erreichte das höchste politische Amt, das eine Frau bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland inne gehabt hat. Sie selbst betrachtete sich jedoch immer als ‚Alibifrau‘.
Elisabeth Schwarzhaupt studierte Jura, promovierte und arbeitete bis 1933 als Richterin. Durch den Nationalsozialismus konnte sie diese Tätigkeit nicht weiter ausüben. Sie setze sich früh mit der Frage auseinander, wie die Rolle der Frau aussehen könnte, um gleichzeitig eine Familie gründen und berufstätig sein zu können. So kam sie auch zur Politik. Sie wollte die zeitgenössische Frauenrolle, auf die häusliche Sphäre reduziert zu sein, nicht übernehmen. Als Juristin spezialisierte sie sich auf das Familienrecht und lernte dieses als ein Recht kennen, das Frauen weitgehend als unmündig behandelte.
1953 trat sie in die CDU ein und kandidierte bei der Wahl zum Zweiten Deutschen Bundestag. Wie auch in den folgenden drei Legislaturperioden zog sie in den Bundestag ein und wirkte an der Reform des Familienrechts mit. Sie setzte sich, auch gegen ihre eigene Partei, für die Streichung des sogenannten ‚Gehorsamsparagraphen‘, für die Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes und für die Reform des Scheidungsrechts ein.
Als erste Ministerin sah sie sich neben den eigentlichen Aufgaben mit zahlreichen Widerständen aus den Reihen ihrer Kabinettskollegen, der eigenen Fraktion und deren Frauengruppe konfrontiert. Neben dem Contergan-Skandal fallen in ihre Amtszeit die Forcierung der Ernährungsberatung sowie die Einführung der Polio-Schluckimpfung und der Krebsvorsorge bei Frauen als Pflichtleistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Doch Elisabeth Schwarzhaupt wurde in ihrem Ressort nicht wirklich heimisch und stellte es 1966 zur Verfügung, um als einfache Abgeordnete in den Bundestag zurückzukehren und sich wieder dem Familienrecht zu widmen. 1969 kandidierte sie nicht mehr für den Bundestag, engagierte sich aber unter anderem im Vorstand des Deutschen Frauenrates, des Evangelischen Frauenbundes, des Deutschen Akademikerinnenbundes und des Deutschen Juristinnenbundes. Bis zu ihrem Tod 1986 nahm Elisabeth Schwarzhaupt immer wieder Stellung zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht und zur Rolle der Frau in einer veränderten Gesellschaft und wollte möglichst viele Frauen politisch mobilisieren.

1961 Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
1961
Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
Als am 14. November 1961 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986) als Bundesministerin für Gesundheitswesen berufen wurde, war es der Initiative von Helene Weber zu verdanken, dass Konrad Adenauer erstmals eine Frau ins Kabinett aufnahm und Elisabeth Schwarzhaupt an die Spitze des neu eingerichteten Ministeriums berief. Die CDU-Politikerin war damit die erste Frau an der Spitze eines Bundesministeriums in Deutschland und erreichte das höchste politische Amt, das eine Frau bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland inne gehabt hat. Sie selbst betrachtete sich jedoch immer als ‚Alibifrau‘.
Elisabeth Schwarzhaupt studierte Jura, promovierte und arbeitete bis 1933 als Richterin. Durch den Nationalsozialismus konnte sie diese Tätigkeit nicht weiter ausüben. Sie setze sich früh mit der Frage auseinander, wie die Rolle der Frau aussehen könnte, um gleichzeitig eine Familie gründen und berufstätig sein zu können. So kam sie auch zur Politik. Sie wollte die zeitgenössische Frauenrolle, auf die häusliche Sphäre reduziert zu sein, nicht übernehmen. Als Juristin spezialisierte sie sich auf das Familienrecht und lernte dieses als ein Recht kennen, das Frauen weitgehend als unmündig behandelte.
1953 trat sie in die CDU ein und kandidierte bei der Wahl zum Zweiten Deutschen Bundestag. Wie auch in den folgenden drei Legislaturperioden zog sie in den Bundestag ein und wirkte an der Reform des Familienrechts mit. Sie setzte sich, auch gegen ihre eigene Partei, für die Streichung des sogenannten ‚Gehorsamsparagraphen‘, für die Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes und für die Reform des Scheidungsrechts ein.
Als erste Ministerin sah sie sich neben den eigentlichen Aufgaben mit zahlreichen Widerständen aus den Reihen ihrer Kabinettskollegen, der eigenen Fraktion und deren Frauengruppe konfrontiert. Neben dem Contergan-Skandal fallen in ihre Amtszeit die Forcierung der Ernährungsberatung sowie die Einführung der Polio-Schluckimpfung und der Krebsvorsorge bei Frauen als Pflichtleistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Doch Elisabeth Schwarzhaupt wurde in ihrem Ressort nicht wirklich heimisch und stellte es 1966 zur Verfügung, um als einfache Abgeordnete in den Bundestag zurückzukehren und sich wieder dem Familienrecht zu widmen. 1969 kandidierte sie nicht mehr für den Bundestag, engagierte sich aber unter anderem im Vorstand des Deutschen Frauenrates, des Evangelischen Frauenbundes, des Deutschen Akademikerinnenbundes und des Deutschen Juristinnenbundes. Bis zu ihrem Tod 1986 nahm Elisabeth Schwarzhaupt immer wieder Stellung zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht und zur Rolle der Frau in einer veränderten Gesellschaft und wollte möglichst viele Frauen politisch mobilisieren.
1961 Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
1961
Elisabeth Schwarzhaupt – Die erste Bundesministerin
Als am 14. November 1961 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986) als Bundesministerin für Gesundheitswesen berufen wurde, war es der Initiative von Helene Weber zu verdanken, dass Konrad Adenauer erstmals eine Frau ins Kabinett aufnahm und Elisabeth Schwarzhaupt an die Spitze des neu eingerichteten Ministeriums berief. Die CDU-Politikerin war damit die erste Frau an der Spitze eines Bundesministeriums in Deutschland und erreichte das höchste politische Amt, das eine Frau bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland inne gehabt hat. Sie selbst betrachtete sich jedoch immer als ‚Alibifrau‘.
Elisabeth Schwarzhaupt studierte Jura, promovierte und arbeitete bis 1933 als Richterin. Durch den Nationalsozialismus konnte sie diese Tätigkeit nicht weiter ausüben. Sie setze sich früh mit der Frage auseinander, wie die Rolle der Frau aussehen könnte, um gleichzeitig eine Familie gründen und berufstätig sein zu können. So kam sie auch zur Politik. Sie wollte die zeitgenössische Frauenrolle, auf die häusliche Sphäre reduziert zu sein, nicht übernehmen. Als Juristin spezialisierte sie sich auf das Familienrecht und lernte dieses als ein Recht kennen, das Frauen weitgehend als unmündig behandelte.
1953 trat sie in die CDU ein und kandidierte bei der Wahl zum Zweiten Deutschen Bundestag. Wie auch in den folgenden drei Legislaturperioden zog sie in den Bundestag ein und wirkte an der Reform des Familienrechts mit. Sie setzte sich, auch gegen ihre eigene Partei, für die Streichung des sogenannten ‚Gehorsamsparagraphen‘, für die Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes und für die Reform des Scheidungsrechts ein.
Als erste Ministerin sah sie sich neben den eigentlichen Aufgaben mit zahlreichen Widerständen aus den Reihen ihrer Kabinettskollegen, der eigenen Fraktion und deren Frauengruppe konfrontiert. Neben dem Contergan-Skandal fallen in ihre Amtszeit die Forcierung der Ernährungsberatung sowie die Einführung der Polio-Schluckimpfung und der Krebsvorsorge bei Frauen als Pflichtleistungen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Doch Elisabeth Schwarzhaupt wurde in ihrem Ressort nicht wirklich heimisch und stellte es 1966 zur Verfügung, um als einfache Abgeordnete in den Bundestag zurückzukehren und sich wieder dem Familienrecht zu widmen. 1969 kandidierte sie nicht mehr für den Bundestag, engagierte sich aber unter anderem im Vorstand des Deutschen Frauenrates, des Evangelischen Frauenbundes, des Deutschen Akademikerinnenbundes und des Deutschen Juristinnenbundes. Bis zu ihrem Tod 1986 nahm Elisabeth Schwarzhaupt immer wieder Stellung zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht und zur Rolle der Frau in einer veränderten Gesellschaft und wollte möglichst viele Frauen politisch mobilisieren.

1968 Eine neue Welle des Protests
1968
Eine neue Welle des Protests
Das Jahr 1968 besitzt rückblickend Symbolcharakter, war es doch das Startsignal für eine zweite Welle der Frauenbewegung. Nicht zuletzt die Tomaten, die auf dem Delegiertenkongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Richtung Vorstandstisch geworfen wurden, sorgten dafür, dass Frauengruppen mit zunehmend spektakulären Aktionen auf bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machten. In diesem Jahr hielt Helke Sander als einzige Frau auf der Delegiertenkonferenz des SDS eine Rede und stellte das Konzept des Aktionsrates zur Befreiung der Frauen (APO) vor. Die feministische Gruppierung setzte sich für die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf ein. Helke Sander formulierte in ihrer Rede, dass die Trennung zwischen Privatleben und gesellschaftlichem Leben die Frau immer in den individuell auszutragenden Konflikt ihrer Isolation zurückwerfe. Die pointierte Formulierung dieser Zeit „Das Private ist politisch“ meint demnach, dass das, was als privat von der Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, höchst politisch ist. Helke Sanders Rede forderte die Genossen zum Umdenken auf, doch dazu waren die Männer nicht bereit. Erbost über deren Reaktion warf die hochschulpolitische Aktivistin Sigrid Rüger Tomaten auf das Podium, eine gelungene Provokation zum richtigen Zeitpunkt. Denn die neue Frauenbewegung nahm dann in den 1970er Jahren Fahrt auf. Das Motto lautete: „Wer sich nicht wehrt, bleibt für immer am Herd.“
Am 6. Juni 1971 titelte die Zeitschrift Stern „Wir haben abgetrieben.“ Es war eine von Alice Schwarzer initiierte Kampagne, bei der 374 Frauen, darunter auch sehr prominente, öffentlich bekannten, eine Schwangerschaft abgebrochen und damit gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Durch die aufsehenerregende Aktion wurde das Tabuthema Schwangerschaftsabbruch erstmals öffentlich. In der Folge davon gründeten sich feministische Gruppen, die sich gegen den Paragraphen 218 engagierten. Im Jahr 1974 führte der Bundestag die Fristenlösung ein, die auf Grund massiver Proteste im Jahr 1976 in die Indikationenregelung umgewandelt wurde. Als Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch galten ab sofort medizinische, kriminologische, eugenische oder soziale Gründe, bei denen eine Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei ist.
1968 Eine neue Welle des Protests
1968
Eine neue Welle des Protests
Das Jahr 1968 besitzt rückblickend Symbolcharakter, war es doch das Startsignal für eine zweite Welle der Frauenbewegung. Nicht zuletzt die Tomaten, die auf dem Delegiertenkongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Richtung Vorstandstisch geworfen wurden, sorgten dafür, dass Frauengruppen mit zunehmend spektakulären Aktionen auf bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machten. In diesem Jahr hielt Helke Sander als einzige Frau auf der Delegiertenkonferenz des SDS eine Rede und stellte das Konzept des Aktionsrates zur Befreiung der Frauen (APO) vor. Die feministische Gruppierung setzte sich für die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf ein. Helke Sander formulierte in ihrer Rede, dass die Trennung zwischen Privatleben und gesellschaftlichem Leben die Frau immer in den individuell auszutragenden Konflikt ihrer Isolation zurückwerfe. Die pointierte Formulierung dieser Zeit „Das Private ist politisch“ meint demnach, dass das, was als privat von der Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, höchst politisch ist. Helke Sanders Rede forderte die Genossen zum Umdenken auf, doch dazu waren die Männer nicht bereit. Erbost über deren Reaktion warf die hochschulpolitische Aktivistin Sigrid Rüger Tomaten auf das Podium, eine gelungene Provokation zum richtigen Zeitpunkt. Denn die neue Frauenbewegung nahm dann in den 1970er Jahren Fahrt auf. Das Motto lautete: „Wer sich nicht wehrt, bleibt für immer am Herd.“
Am 6. Juni 1971 titelte die Zeitschrift Stern „Wir haben abgetrieben.“ Es war eine von Alice Schwarzer initiierte Kampagne, bei der 374 Frauen, darunter auch sehr prominente, öffentlich bekannten, eine Schwangerschaft abgebrochen und damit gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Durch die aufsehenerregende Aktion wurde das Tabuthema Schwangerschaftsabbruch erstmals öffentlich. In der Folge davon gründeten sich feministische Gruppen, die sich gegen den Paragraphen 218 engagierten. Im Jahr 1974 führte der Bundestag die Fristenlösung ein, die auf Grund massiver Proteste im Jahr 1976 in die Indikationenregelung umgewandelt wurde. Als Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch galten ab sofort medizinische, kriminologische, eugenische oder soziale Gründe, bei denen eine Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei ist.
1970 Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
1970
Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
Am 14. Oktober 1970 löste die SPD-Politikerin Helene-Charlotte (Lenelotte) von Bothmer (1915–1997), die 1969 in den Bundestag eingezogen war, einen Skandal aus, als sie es wagte, in einem Hosenanzug ans Rednerpult des Bundestags zu treten. Der Aktion war allerdings etwas vorausgegangen: Der Vizepräsident des Bundestags, Richard Jaeger (CSU), hatte erklärt, er würde keiner Frau erlauben, das Plenum in Hosen zu betreten, geschweige denn an das Rednerpult zu treten. Von dieser Äußerung fühlten sich einige Politikerinnen provoziert. Sie berieten darüber, wie zu reagieren sei, und entschieden, genau das zu tun, was ihnen verwehrt sein sollte.
Für die Aktion wurde dann die 54-jährige sechsfache Mutter Lenelotte von Bothmer – und eigentlich passionierte Rockträgerin – ausgewählt. Sie kaufte sich einen beigefarbenen Hosenanzug mit hochgeschlossener Jacke, betrat mit diesem bekleidet den Bundestag und hielt eine Rede. Atemloses Schweigen soll über dem Parlament gelegen haben, bevor ein Sturm der Entrüstung losbrach. Carlo Schmid (SPD) wähnte die Würde des Hohen Hauses verletzt, Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger (CSU) die Würde der Frau.
Worum es in der Rede ging, die sich mit Schulpolitik beschäftigte, ist in Vergessenheit geraten, es interessierte auch damals niemanden so besonders. Aber Lenelotte von Bothmer hatte sich mit diesem Auftritt ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie erhielt daraufhin eine Vielzahl von anonymen Schreiben, in denen sie zum Teil heftig beschimpft wurde. In einem wurde ihr vorgeworfen, ein unanständiges würdeloses Weib zu sein.
Lenelotte von Bothmer gehörte unter anderem den Bundestags-Ausschüssen für Bildung und Wissenschaft sowie für Auswärtige Angelegenheiten an und engagierte sich insbesondere in der Friedenspolitik. Bis 1980 blieb sie im Bundestag, aber mehr als alle Schriften und Reden blieb von ihr das Bild einer Frau in Erinnerung, die mit Handtasche und in Hosen am Rednerpult steht. Nach ihrer Zeit als aktive Politikerin wurde sie Schriftstellerin.

1970 Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
1970
Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
Am 14. Oktober 1970 löste die SPD-Politikerin Helene-Charlotte (Lenelotte) von Bothmer (1915–1997), die 1969 in den Bundestag eingezogen war, einen Skandal aus, als sie es wagte, in einem Hosenanzug ans Rednerpult des Bundestags zu treten. Der Aktion war allerdings etwas vorausgegangen: Der Vizepräsident des Bundestags, Richard Jaeger (CSU), hatte erklärt, er würde keiner Frau erlauben, das Plenum in Hosen zu betreten, geschweige denn an das Rednerpult zu treten. Von dieser Äußerung fühlten sich einige Politikerinnen provoziert. Sie berieten darüber, wie zu reagieren sei, und entschieden, genau das zu tun, was ihnen verwehrt sein sollte.
Für die Aktion wurde dann die 54-jährige sechsfache Mutter Lenelotte von Bothmer – und eigentlich passionierte Rockträgerin – ausgewählt. Sie kaufte sich einen beigefarbenen Hosenanzug mit hochgeschlossener Jacke, betrat mit diesem bekleidet den Bundestag und hielt eine Rede. Atemloses Schweigen soll über dem Parlament gelegen haben, bevor ein Sturm der Entrüstung losbrach. Carlo Schmid (SPD) wähnte die Würde des Hohen Hauses verletzt, Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger (CSU) die Würde der Frau.
Worum es in der Rede ging, die sich mit Schulpolitik beschäftigte, ist in Vergessenheit geraten, es interessierte auch damals niemanden so besonders. Aber Lenelotte von Bothmer hatte sich mit diesem Auftritt ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie erhielt daraufhin eine Vielzahl von anonymen Schreiben, in denen sie zum Teil heftig beschimpft wurde. In einem wurde ihr vorgeworfen, ein unanständiges würdeloses Weib zu sein.
Lenelotte von Bothmer gehörte unter anderem den Bundestags-Ausschüssen für Bildung und Wissenschaft sowie für Auswärtige Angelegenheiten an und engagierte sich insbesondere in der Friedenspolitik. Bis 1980 blieb sie im Bundestag, aber mehr als alle Schriften und Reden blieb von ihr das Bild einer Frau in Erinnerung, die mit Handtasche und in Hosen am Rednerpult steht. Nach ihrer Zeit als aktive Politikerin wurde sie Schriftstellerin.

1970 Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
1970
Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
Am 14. Oktober 1970 löste die SPD-Politikerin Helene-Charlotte (Lenelotte) von Bothmer (1915–1997), die 1969 in den Bundestag eingezogen war, einen Skandal aus, als sie es wagte, in einem Hosenanzug ans Rednerpult des Bundestags zu treten. Der Aktion war allerdings etwas vorausgegangen: Der Vizepräsident des Bundestags, Richard Jaeger (CSU), hatte erklärt, er würde keiner Frau erlauben, das Plenum in Hosen zu betreten, geschweige denn an das Rednerpult zu treten. Von dieser Äußerung fühlten sich einige Politikerinnen provoziert. Sie berieten darüber, wie zu reagieren sei, und entschieden, genau das zu tun, was ihnen verwehrt sein sollte.
Für die Aktion wurde dann die 54-jährige sechsfache Mutter Lenelotte von Bothmer – und eigentlich passionierte Rockträgerin – ausgewählt. Sie kaufte sich einen beigefarbenen Hosenanzug mit hochgeschlossener Jacke, betrat mit diesem bekleidet den Bundestag und hielt eine Rede. Atemloses Schweigen soll über dem Parlament gelegen haben, bevor ein Sturm der Entrüstung losbrach. Carlo Schmid (SPD) wähnte die Würde des Hohen Hauses verletzt, Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger (CSU) die Würde der Frau.
Worum es in der Rede ging, die sich mit Schulpolitik beschäftigte, ist in Vergessenheit geraten, es interessierte auch damals niemanden so besonders. Aber Lenelotte von Bothmer hatte sich mit diesem Auftritt ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie erhielt daraufhin eine Vielzahl von anonymen Schreiben, in denen sie zum Teil heftig beschimpft wurde. In einem wurde ihr vorgeworfen, ein unanständiges würdeloses Weib zu sein.
Lenelotte von Bothmer gehörte unter anderem den Bundestags-Ausschüssen für Bildung und Wissenschaft sowie für Auswärtige Angelegenheiten an und engagierte sich insbesondere in der Friedenspolitik. Bis 1980 blieb sie im Bundestag, aber mehr als alle Schriften und Reden blieb von ihr das Bild einer Frau in Erinnerung, die mit Handtasche und in Hosen am Rednerpult steht. Nach ihrer Zeit als aktive Politikerin wurde sie Schriftstellerin.
1970 Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
1970
Lenelotte von Bothmer – Die erste Bundestagsrede einer Frau im Hosenanzug
Am 14. Oktober 1970 löste die SPD-Politikerin Helene-Charlotte (Lenelotte) von Bothmer (1915–1997), die 1969 in den Bundestag eingezogen war, einen Skandal aus, als sie es wagte, in einem Hosenanzug ans Rednerpult des Bundestags zu treten. Der Aktion war allerdings etwas vorausgegangen: Der Vizepräsident des Bundestags, Richard Jaeger (CSU), hatte erklärt, er würde keiner Frau erlauben, das Plenum in Hosen zu betreten, geschweige denn an das Rednerpult zu treten. Von dieser Äußerung fühlten sich einige Politikerinnen provoziert. Sie berieten darüber, wie zu reagieren sei, und entschieden, genau das zu tun, was ihnen verwehrt sein sollte.
Für die Aktion wurde dann die 54-jährige sechsfache Mutter Lenelotte von Bothmer – und eigentlich passionierte Rockträgerin – ausgewählt. Sie kaufte sich einen beigefarbenen Hosenanzug mit hochgeschlossener Jacke, betrat mit diesem bekleidet den Bundestag und hielt eine Rede. Atemloses Schweigen soll über dem Parlament gelegen haben, bevor ein Sturm der Entrüstung losbrach. Carlo Schmid (SPD) wähnte die Würde des Hohen Hauses verletzt, Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger (CSU) die Würde der Frau.
Worum es in der Rede ging, die sich mit Schulpolitik beschäftigte, ist in Vergessenheit geraten, es interessierte auch damals niemanden so besonders. Aber Lenelotte von Bothmer hatte sich mit diesem Auftritt ihren Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie erhielt daraufhin eine Vielzahl von anonymen Schreiben, in denen sie zum Teil heftig beschimpft wurde. In einem wurde ihr vorgeworfen, ein unanständiges würdeloses Weib zu sein.
Lenelotte von Bothmer gehörte unter anderem den Bundestags-Ausschüssen für Bildung und Wissenschaft sowie für Auswärtige Angelegenheiten an und engagierte sich insbesondere in der Friedenspolitik. Bis 1980 blieb sie im Bundestag, aber mehr als alle Schriften und Reden blieb von ihr das Bild einer Frau in Erinnerung, die mit Handtasche und in Hosen am Rednerpult steht. Nach ihrer Zeit als aktive Politikerin wurde sie Schriftstellerin.

1977 Reform des Ehe- und Familienrechts
1977
Reform des Ehe- und Familienrechts
Obwohl der ‚Gehorsamsparagraph‘ ersatzlos gestrichen worden war, waren es immer noch die Frauen, die die Verantwortung für den Haushalt trugen. Zwar konnten sie erwerbstätig sein, aber nur, wenn dies mit ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter zu vereinbaren war.
Die geplante Reform des Ehe- und Familienrechts war eine grundlegende Neuregelung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt. Grundlage waren die schon 1970 vorgelegten Empfehlungen einer Sachverständigenkommission. Durch die vorzeitige Auflösung des Bundestags 1972 wurde ein entsprechender erster Entwurf erst 1973 beraten. Die parlamentarische Beratung des Entwurfs zog sich bis 1976 hin, so dass das neue Gesetz erst im Juni 1976 verkündet wurde. Es trat am 1. Juli 1977 in Kraft. In seinem ersten Teil enthält es die Eherechtsreform, im zweiten die Reform des Scheidungsrechts und im dritten Teil wird das Scheidungsverfahren neu geordnet. Aber keines der fünf Bücher des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches wurde so grundlegend geändert wie das Buch mit der Überschrift ‚Familienrecht‘.
Bei seinen wichtigsten Bestimmungen, die die Ehe, die Ehescheidung und das Verhältnis zwischen Eltern und Kinder betreffen, ist fast nichts so geblieben wie es ursprünglich war.
Durch die Reform wurde die sogenannte Hausfrauenehe überwunden und durch das Partnerschaftsprinzip ersetzt. Jetzt gibt es für die Ehe keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung mehr, diese ist den Eheleuten überlassen.
Im Fall einer Scheidung wurde das bisherige Verschuldensprinzip verworfen und durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt. Danach muss nach dem Scheitern einer Ehe ungeachtet des Verschuldens stets der wirtschaftlich stärkere Partner dem wirtschaftlich Schwächeren Unterhalt zahlen. Zusätzlich wurde der Versorgungsausgleich eingeführt, durch den bei einer Scheidung der Rentenanspruch geregelt wurde.
Weiterer Bestandteil des neuen Eherechts war das Namensrecht. Auch Männer konnten ab jetzt den Namen ihrer Ehefrau annehmen. Konnten sich die Eheleute allerdings nicht einigen, wurde automatisch der Name des Mannes zum Ehenamen.
Außerdem wurden die Familiengerichte eingeführt.
1977 Reform des Ehe- und Familienrechts
1977
Reform des Ehe- und Familienrechts
Obwohl der ‚Gehorsamsparagraph‘ ersatzlos gestrichen worden war, waren es immer noch die Frauen, die die Verantwortung für den Haushalt trugen. Zwar konnten sie erwerbstätig sein, aber nur, wenn dies mit ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter zu vereinbaren war.
Die geplante Reform des Ehe- und Familienrechts war eine grundlegende Neuregelung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt. Grundlage waren die schon 1970 vorgelegten Empfehlungen einer Sachverständigenkommission. Durch die vorzeitige Auflösung des Bundestags 1972 wurde ein entsprechender erster Entwurf erst 1973 beraten. Die parlamentarische Beratung des Entwurfs zog sich bis 1976 hin, so dass das neue Gesetz erst im Juni 1976 verkündet wurde. Es trat am 1. Juli 1977 in Kraft. In seinem ersten Teil enthält es die Eherechtsreform, im zweiten die Reform des Scheidungsrechts und im dritten Teil wird das Scheidungsverfahren neu geordnet. Aber keines der fünf Bücher des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches wurde so grundlegend geändert wie das Buch mit der Überschrift ‚Familienrecht‘.
Bei seinen wichtigsten Bestimmungen, die die Ehe, die Ehescheidung und das Verhältnis zwischen Eltern und Kinder betreffen, ist fast nichts so geblieben wie es ursprünglich war.
Durch die Reform wurde die sogenannte Hausfrauenehe überwunden und durch das Partnerschaftsprinzip ersetzt. Jetzt gibt es für die Ehe keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung mehr, diese ist den Eheleuten überlassen.
Im Fall einer Scheidung wurde das bisherige Verschuldensprinzip verworfen und durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt. Danach muss nach dem Scheitern einer Ehe ungeachtet des Verschuldens stets der wirtschaftlich stärkere Partner dem wirtschaftlich Schwächeren Unterhalt zahlen. Zusätzlich wurde der Versorgungsausgleich eingeführt, durch den bei einer Scheidung der Rentenanspruch geregelt wurde.
Weiterer Bestandteil des neuen Eherechts war das Namensrecht. Auch Männer konnten ab jetzt den Namen ihrer Ehefrau annehmen. Konnten sich die Eheleute allerdings nicht einigen, wurde automatisch der Name des Mannes zum Ehenamen.
Außerdem wurden die Familiengerichte eingeführt.
1986 Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1986
Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1985 wurde die CDU-Politikerin Rita Süssmuth (geb. 1937) die Nachfolgerin von Heiner Geißler (CDU) und damit Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Im Juni 1986 wurde das Bundesministerium um die neue Abteilung Frauenpolitik erweitert, Rita Süssmuth war jetzt Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und damit die erste Frauenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Amtsbezeichnungen für Ministerinnen und Minister waren damals noch rein männlich und das Schild an der Tür der ersten Frauenministerin wies Prof.in Dr. Rita Süssmuth als ‚Bundesminister‘ aus.
Rita Süssmuth promovierte 1964 und übte, bevor sie in die Politik wechselte, bis 1982 zahlreiche wissenschaftliche Tätigkeiten aus: 1971 wurde sie zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr ernannt, 1973 nahm sie den Ruf der Universität Dortmund an. Parallel dazu begann sie sich politisch zu engagieren und arbeitete von 1971 bis 1985 im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums mit. 1977 wurde sie zudem Mitglied in der dritten Familienberichtskommission. 1981 trat sie der CDU bei und erregte insbesondere durch ihre Arbeit im Fachausschuss Familienpolitik Aufmerksamkeit. In den Jahren 1982 bis 1985 leitete sie das Forschungsinstitut ‚Frau und Gesellschaft‘ in Hannover. Von 1987 bis 2002 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags, von 1988 bis 1998 war sie Bundestagspräsidentin. Sie hatte von 1986 bis 2001 den Vorsitz der Frauen Union inne, war von 1987 bis 1998 Mitglied des CDU-Präsidiums und saß zwischen 2000 und 2001 der Unabhängigen Kommission Zuwanderung vor.
Während ihrer Amtszeit als Ministerin musste Rita Süssmuth erfahren, dass sich die Akzeptanz für frauen- und familienpolitische Positionen in Grenzen hielt. Heftig umstritten war zu dieser Zeit die familienergänzende Frühförderung und Betreuung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war ein kontrovers diskutiertes Thema. Viele Frauen sahen sich damals mit der Situation konfrontiert, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen. In Rita Süssmuths Amtszeit fällt unter anderem das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Pro Kind wurde zunächst ein Jahr in der Rentenversicherung anerkannt. Zum 80. Geburtstag wurde Rita Süssmuth von der Süddeutschen Zeitung als die Frau bezeichnet, die der CDU den Feminismus beibrachte, ihr Ministerium als Emanzipationszentrale. Rückblickend zieht sie selbst die Bilanz, dass sie durch ihr Engagement in der Frauenforschung und -politik erfuhr, was Ausgrenzung, Geringschätzung und Diskriminierung bedeuten.

1986 Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1986
Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1985 wurde die CDU-Politikerin Rita Süssmuth (geb. 1937) die Nachfolgerin von Heiner Geißler (CDU) und damit Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Im Juni 1986 wurde das Bundesministerium um die neue Abteilung Frauenpolitik erweitert, Rita Süssmuth war jetzt Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und damit die erste Frauenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Amtsbezeichnungen für Ministerinnen und Minister waren damals noch rein männlich und das Schild an der Tür der ersten Frauenministerin wies Prof.in Dr. Rita Süssmuth als ‚Bundesminister‘ aus.
Rita Süssmuth promovierte 1964 und übte, bevor sie in die Politik wechselte, bis 1982 zahlreiche wissenschaftliche Tätigkeiten aus: 1971 wurde sie zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr ernannt, 1973 nahm sie den Ruf der Universität Dortmund an. Parallel dazu begann sie sich politisch zu engagieren und arbeitete von 1971 bis 1985 im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums mit. 1977 wurde sie zudem Mitglied in der dritten Familienberichtskommission. 1981 trat sie der CDU bei und erregte insbesondere durch ihre Arbeit im Fachausschuss Familienpolitik Aufmerksamkeit. In den Jahren 1982 bis 1985 leitete sie das Forschungsinstitut ‚Frau und Gesellschaft‘ in Hannover. Von 1987 bis 2002 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags, von 1988 bis 1998 war sie Bundestagspräsidentin. Sie hatte von 1986 bis 2001 den Vorsitz der Frauen Union inne, war von 1987 bis 1998 Mitglied des CDU-Präsidiums und saß zwischen 2000 und 2001 der Unabhängigen Kommission Zuwanderung vor.
Während ihrer Amtszeit als Ministerin musste Rita Süssmuth erfahren, dass sich die Akzeptanz für frauen- und familienpolitische Positionen in Grenzen hielt. Heftig umstritten war zu dieser Zeit die familienergänzende Frühförderung und Betreuung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war ein kontrovers diskutiertes Thema. Viele Frauen sahen sich damals mit der Situation konfrontiert, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen. In Rita Süssmuths Amtszeit fällt unter anderem das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Pro Kind wurde zunächst ein Jahr in der Rentenversicherung anerkannt. Zum 80. Geburtstag wurde Rita Süssmuth von der Süddeutschen Zeitung als die Frau bezeichnet, die der CDU den Feminismus beibrachte, ihr Ministerium als Emanzipationszentrale. Rückblickend zieht sie selbst die Bilanz, dass sie durch ihr Engagement in der Frauenforschung und -politik erfuhr, was Ausgrenzung, Geringschätzung und Diskriminierung bedeuten.

1986 Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1986
Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1985 wurde die CDU-Politikerin Rita Süssmuth (geb. 1937) die Nachfolgerin von Heiner Geißler (CDU) und damit Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Im Juni 1986 wurde das Bundesministerium um die neue Abteilung Frauenpolitik erweitert, Rita Süssmuth war jetzt Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und damit die erste Frauenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Amtsbezeichnungen für Ministerinnen und Minister waren damals noch rein männlich und das Schild an der Tür der ersten Frauenministerin wies Prof.in Dr. Rita Süssmuth als ‚Bundesminister‘ aus.
Rita Süssmuth promovierte 1964 und übte, bevor sie in die Politik wechselte, bis 1982 zahlreiche wissenschaftliche Tätigkeiten aus: 1971 wurde sie zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr ernannt, 1973 nahm sie den Ruf der Universität Dortmund an. Parallel dazu begann sie sich politisch zu engagieren und arbeitete von 1971 bis 1985 im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums mit. 1977 wurde sie zudem Mitglied in der dritten Familienberichtskommission. 1981 trat sie der CDU bei und erregte insbesondere durch ihre Arbeit im Fachausschuss Familienpolitik Aufmerksamkeit. In den Jahren 1982 bis 1985 leitete sie das Forschungsinstitut ‚Frau und Gesellschaft‘ in Hannover. Von 1987 bis 2002 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags, von 1988 bis 1998 war sie Bundestagspräsidentin. Sie hatte von 1986 bis 2001 den Vorsitz der Frauen Union inne, war von 1987 bis 1998 Mitglied des CDU-Präsidiums und saß zwischen 2000 und 2001 der Unabhängigen Kommission Zuwanderung vor.
Während ihrer Amtszeit als Ministerin musste Rita Süssmuth erfahren, dass sich die Akzeptanz für frauen- und familienpolitische Positionen in Grenzen hielt. Heftig umstritten war zu dieser Zeit die familienergänzende Frühförderung und Betreuung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war ein kontrovers diskutiertes Thema. Viele Frauen sahen sich damals mit der Situation konfrontiert, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen. In Rita Süssmuths Amtszeit fällt unter anderem das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Pro Kind wurde zunächst ein Jahr in der Rentenversicherung anerkannt. Zum 80. Geburtstag wurde Rita Süssmuth von der Süddeutschen Zeitung als die Frau bezeichnet, die der CDU den Feminismus beibrachte, ihr Ministerium als Emanzipationszentrale. Rückblickend zieht sie selbst die Bilanz, dass sie durch ihr Engagement in der Frauenforschung und -politik erfuhr, was Ausgrenzung, Geringschätzung und Diskriminierung bedeuten.
1986 Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1986
Rita Süssmuth – Die erste Frauenministerin
1985 wurde die CDU-Politikerin Rita Süssmuth (geb. 1937) die Nachfolgerin von Heiner Geißler (CDU) und damit Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Im Juni 1986 wurde das Bundesministerium um die neue Abteilung Frauenpolitik erweitert, Rita Süssmuth war jetzt Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und damit die erste Frauenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die Amtsbezeichnungen für Ministerinnen und Minister waren damals noch rein männlich und das Schild an der Tür der ersten Frauenministerin wies Prof.in Dr. Rita Süssmuth als ‚Bundesminister‘ aus.
Rita Süssmuth promovierte 1964 und übte, bevor sie in die Politik wechselte, bis 1982 zahlreiche wissenschaftliche Tätigkeiten aus: 1971 wurde sie zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr ernannt, 1973 nahm sie den Ruf der Universität Dortmund an. Parallel dazu begann sie sich politisch zu engagieren und arbeitete von 1971 bis 1985 im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums mit. 1977 wurde sie zudem Mitglied in der dritten Familienberichtskommission. 1981 trat sie der CDU bei und erregte insbesondere durch ihre Arbeit im Fachausschuss Familienpolitik Aufmerksamkeit. In den Jahren 1982 bis 1985 leitete sie das Forschungsinstitut ‚Frau und Gesellschaft‘ in Hannover. Von 1987 bis 2002 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags, von 1988 bis 1998 war sie Bundestagspräsidentin. Sie hatte von 1986 bis 2001 den Vorsitz der Frauen Union inne, war von 1987 bis 1998 Mitglied des CDU-Präsidiums und saß zwischen 2000 und 2001 der Unabhängigen Kommission Zuwanderung vor.
Während ihrer Amtszeit als Ministerin musste Rita Süssmuth erfahren, dass sich die Akzeptanz für frauen- und familienpolitische Positionen in Grenzen hielt. Heftig umstritten war zu dieser Zeit die familienergänzende Frühförderung und Betreuung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war ein kontrovers diskutiertes Thema. Viele Frauen sahen sich damals mit der Situation konfrontiert, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen. In Rita Süssmuths Amtszeit fällt unter anderem das Gesetz zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Pro Kind wurde zunächst ein Jahr in der Rentenversicherung anerkannt. Zum 80. Geburtstag wurde Rita Süssmuth von der Süddeutschen Zeitung als die Frau bezeichnet, die der CDU den Feminismus beibrachte, ihr Ministerium als Emanzipationszentrale. Rückblickend zieht sie selbst die Bilanz, dass sie durch ihr Engagement in der Frauenforschung und -politik erfuhr, was Ausgrenzung, Geringschätzung und Diskriminierung bedeuten.

1993 Heide Simonis – Die erste Ministerpräsidentin
1993
Heide Simonis – Die erste Ministerpräsidentin
Am 19. Mai 1993 wurde die SPD-Politikerin Heide Simonis (geb. 1943) in das Amt der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein gewählt, zwei Wochen nachdem Björn Engholm von seinem Amt als Ministerpräsident zurückgetreten war. Heide Simonis war damit die erste und bis zur Wahl von Christine Lieberknecht zur Thüringer Ministerpräsidentin im Jahr 2009 einzige Frau, die als Ministerpräsidentin an der Spitze eines Bundeslandes stand. Nachdem die SPD bei der Landtagswahl von 1996 die absolute Mehrheit verloren hatte, bildete sie mit den Grünen eine Koalition, die auch bei der Landtagswahl 2000 bestätigt wurde.
Als Heide Simonis das erste Mal zum Ministerpräsidenten-Treffen kam, begann Kurt Biedenkopf als Sprecher die Begrüßung mit den Worten „Meine Herren Kollegen“. Ein Mitarbeiter soll ihm ein Zeichen gegeben haben, denn dann folgte „… und Frau Simonis“.
Heide Simonis war 1969 in die SPD eingetreten und wurde 1976 in den Deutschen Bundestag gewählt. Von 1988 bis 1991 gehörte sie dem Bundesvorstand der SPD an. Ihren Ruf hatte sie sich als Finanzministerin erworben. Als solche war sie von August 1990 bis Mai 1993 Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und wurde für ihre konsequente Haltung bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 1992 bekannt.
Am 10. März 1993 wurde sie Stellvertreterin von Ministerpräsident Björn Engholm und galt neben zwei männlichen Kollegen als dessen potentielle Nachfolgerin, da Björn Engholm Kanzlerkandidat der SPD werden sollte. Es war nicht abzusehen, ob eine Frau Chancen auf das Amt als Ministerpräsidentin hätte, doch Björn Engholm stolperte über die Barschel-Affäre. Heide Simonis Fazit dazu lautet, dass eine Frau immer erst dann in ein solches Amt gehoben wird, wenn es vorher einen Mann kräftig aus der Kurve getragen hat. Und sie erinnert sich daran, dass es viel Skepsis gegenüber einer Frau in diesem Amt gab.
Nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 20. Februar 2005 war die Frage der Regierungsbildung unsicher, da SPD und Grüne zusammen nur über 33 Mandate und CDU und FDP gemeinsam über 34 Mandate verfügen konnten. Bei der konstituierenden Sitzung des Landtages am 17. März 2005 stellte sich neben Heide Simonis auch der CDU-Landesvorsitzende Peter Harry Carstensen zur Wahl. Beide konnten in vier Wahlgängen die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht auf sich vereinen. Nach Stimmengleichheit im vierten Wahlgang mit je 34 Stimmen für Carstensen und Simonis stellte sie sich für einen weiteren Wahlgang nicht mehr zur Verfügung und leitete bis zur Wahl von Peter Harry Carstensen im fünften Wahlgang am 27. April 2005 als geschäftsführende Ministerpräsidentin die Landesregierung.
1993 Heide Simonis – Die erste Ministerpräsidentin
1993
Heide Simonis – Die erste Ministerpräsidentin
Am 19. Mai 1993 wurde die SPD-Politikerin Heide Simonis (geb. 1943) in das Amt der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein gewählt, zwei Wochen nachdem Björn Engholm von seinem Amt als Ministerpräsident zurückgetreten war. Heide Simonis war damit die erste und bis zur Wahl von Christine Lieberknecht zur Thüringer Ministerpräsidentin im Jahr 2009 einzige Frau, die als Ministerpräsidentin an der Spitze eines Bundeslandes stand. Nachdem die SPD bei der Landtagswahl von 1996 die absolute Mehrheit verloren hatte, bildete sie mit den Grünen eine Koalition, die auch bei der Landtagswahl 2000 bestätigt wurde.
Als Heide Simonis das erste Mal zum Ministerpräsidenten-Treffen kam, begann Kurt Biedenkopf als Sprecher die Begrüßung mit den Worten „Meine Herren Kollegen“. Ein Mitarbeiter soll ihm ein Zeichen gegeben haben, denn dann folgte „… und Frau Simonis“.
Heide Simonis war 1969 in die SPD eingetreten und wurde 1976 in den Deutschen Bundestag gewählt. Von 1988 bis 1991 gehörte sie dem Bundesvorstand der SPD an. Ihren Ruf hatte sie sich als Finanzministerin erworben. Als solche war sie von August 1990 bis Mai 1993 Vorsitzende der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und wurde für ihre konsequente Haltung bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 1992 bekannt.
Am 10. März 1993 wurde sie Stellvertreterin von Ministerpräsident Björn Engholm und galt neben zwei männlichen Kollegen als dessen potentielle Nachfolgerin, da Björn Engholm Kanzlerkandidat der SPD werden sollte. Es war nicht abzusehen, ob eine Frau Chancen auf das Amt als Ministerpräsidentin hätte, doch Björn Engholm stolperte über die Barschel-Affäre. Heide Simonis Fazit dazu lautet, dass eine Frau immer erst dann in ein solches Amt gehoben wird, wenn es vorher einen Mann kräftig aus der Kurve getragen hat. Und sie erinnert sich daran, dass es viel Skepsis gegenüber einer Frau in diesem Amt gab.
Nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 20. Februar 2005 war die Frage der Regierungsbildung unsicher, da SPD und Grüne zusammen nur über 33 Mandate und CDU und FDP gemeinsam über 34 Mandate verfügen konnten. Bei der konstituierenden Sitzung des Landtages am 17. März 2005 stellte sich neben Heide Simonis auch der CDU-Landesvorsitzende Peter Harry Carstensen zur Wahl. Beide konnten in vier Wahlgängen die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht auf sich vereinen. Nach Stimmengleichheit im vierten Wahlgang mit je 34 Stimmen für Carstensen und Simonis stellte sie sich für einen weiteren Wahlgang nicht mehr zur Verfügung und leitete bis zur Wahl von Peter Harry Carstensen im fünften Wahlgang am 27. April 2005 als geschäftsführende Ministerpräsidentin die Landesregierung.
1994 Die Erweiterung des Grundgesetzes
1994
Die Erweiterung des Grundgesetzes
Seit die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen worden war, hatte sich die soziale Wirklichkeit von Frauen trotz unbestreitbarer Fortschritte nur langsam verändert. Nach der Wiedervereinigung erhielt die Gemeinsame Verfassungskommission (GVK) den Auftrag, Grundgesetzänderungen, die durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten notwendig geworden waren, auszuarbeiten. Frauenorganisationen, -verbände und -initiativen setzen sich massiv dafür ein, dass die GVK auch die Weiterentwicklung des Gleichberechtigungsartikels zum Gegenstand ihrer Beratungen machte. Denn mit der bestehenden Formulierung war zwar die formale, nicht jedoch die faktische Gleichstellung zwischen Frauen und Männern erreicht worden.
Die Debatten darüber gestalteten sich schwierig. Einig war man sich in der Kommission darin, dass Frauen weiterhin Benachteiligungen ausgesetzt seien, jedoch war man sich nicht einig darin, mit welchen Maßnahmen diese Benachteiligungen abgebaut werden sollen.
Am 27. Mai 1993 beschloss die GVK die Formulierung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ An den Staat wird damit klar der Auftrag formuliert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv voranzubringen, und der Verfassungszusatz bildet für Bund, Länder und Kommunen die Rechtsgrundlage für Gleichstellungsgesetze.
Am 24. Juni 1994 trat das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (2. GleiBG), in Kraft, bei dem es sich um eine Reform des 1957 beschlossenen Gleichberechtigungsgesetzes handelt. Es beinhaltet in Artikel 1 das Gesetz zur Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bundesverwaltung und den Gerichten des Bundes bzw. Frauenfördergesetz (FFG), in Artikel 10 das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtenschutzgesetz (BSchG) und in Artikel 11 das Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien im Einflussbereich des Bundes bzw. Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG).
Dieses Zweite Gleichberechtigungsgesetz von 1994 wurde 2001 durch das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes bzw. Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) abgelöst.

1994 Die Erweiterung des Grundgesetzes
1994
Die Erweiterung des Grundgesetzes
Seit die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen worden war, hatte sich die soziale Wirklichkeit von Frauen trotz unbestreitbarer Fortschritte nur langsam verändert. Nach der Wiedervereinigung erhielt die Gemeinsame Verfassungskommission (GVK) den Auftrag, Grundgesetzänderungen, die durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten notwendig geworden waren, auszuarbeiten. Frauenorganisationen, -verbände und -initiativen setzen sich massiv dafür ein, dass die GVK auch die Weiterentwicklung des Gleichberechtigungsartikels zum Gegenstand ihrer Beratungen machte. Denn mit der bestehenden Formulierung war zwar die formale, nicht jedoch die faktische Gleichstellung zwischen Frauen und Männern erreicht worden.
Die Debatten darüber gestalteten sich schwierig. Einig war man sich in der Kommission darin, dass Frauen weiterhin Benachteiligungen ausgesetzt seien, jedoch war man sich nicht einig darin, mit welchen Maßnahmen diese Benachteiligungen abgebaut werden sollen.
Am 27. Mai 1993 beschloss die GVK die Formulierung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ An den Staat wird damit klar der Auftrag formuliert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv voranzubringen, und der Verfassungszusatz bildet für Bund, Länder und Kommunen die Rechtsgrundlage für Gleichstellungsgesetze.
Am 24. Juni 1994 trat das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (2. GleiBG), in Kraft, bei dem es sich um eine Reform des 1957 beschlossenen Gleichberechtigungsgesetzes handelt. Es beinhaltet in Artikel 1 das Gesetz zur Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bundesverwaltung und den Gerichten des Bundes bzw. Frauenfördergesetz (FFG), in Artikel 10 das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtenschutzgesetz (BSchG) und in Artikel 11 das Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien im Einflussbereich des Bundes bzw. Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG).
Dieses Zweite Gleichberechtigungsgesetz von 1994 wurde 2001 durch das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes bzw. Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) abgelöst.

1994 Die Erweiterung des Grundgesetzes
1994
Die Erweiterung des Grundgesetzes
Seit die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen worden war, hatte sich die soziale Wirklichkeit von Frauen trotz unbestreitbarer Fortschritte nur langsam verändert. Nach der Wiedervereinigung erhielt die Gemeinsame Verfassungskommission (GVK) den Auftrag, Grundgesetzänderungen, die durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten notwendig geworden waren, auszuarbeiten. Frauenorganisationen, -verbände und -initiativen setzen sich massiv dafür ein, dass die GVK auch die Weiterentwicklung des Gleichberechtigungsartikels zum Gegenstand ihrer Beratungen machte. Denn mit der bestehenden Formulierung war zwar die formale, nicht jedoch die faktische Gleichstellung zwischen Frauen und Männern erreicht worden.
Die Debatten darüber gestalteten sich schwierig. Einig war man sich in der Kommission darin, dass Frauen weiterhin Benachteiligungen ausgesetzt seien, jedoch war man sich nicht einig darin, mit welchen Maßnahmen diese Benachteiligungen abgebaut werden sollen.
Am 27. Mai 1993 beschloss die GVK die Formulierung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ An den Staat wird damit klar der Auftrag formuliert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv voranzubringen, und der Verfassungszusatz bildet für Bund, Länder und Kommunen die Rechtsgrundlage für Gleichstellungsgesetze.
Am 24. Juni 1994 trat das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (2. GleiBG), in Kraft, bei dem es sich um eine Reform des 1957 beschlossenen Gleichberechtigungsgesetzes handelt. Es beinhaltet in Artikel 1 das Gesetz zur Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bundesverwaltung und den Gerichten des Bundes bzw. Frauenfördergesetz (FFG), in Artikel 10 das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtenschutzgesetz (BSchG) und in Artikel 11 das Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien im Einflussbereich des Bundes bzw. Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG).
Dieses Zweite Gleichberechtigungsgesetz von 1994 wurde 2001 durch das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes bzw. Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) abgelöst.
1994 Die Erweiterung des Grundgesetzes
1994
Die Erweiterung des Grundgesetzes
Seit die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz aufgenommen worden war, hatte sich die soziale Wirklichkeit von Frauen trotz unbestreitbarer Fortschritte nur langsam verändert. Nach der Wiedervereinigung erhielt die Gemeinsame Verfassungskommission (GVK) den Auftrag, Grundgesetzänderungen, die durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten notwendig geworden waren, auszuarbeiten. Frauenorganisationen, -verbände und -initiativen setzen sich massiv dafür ein, dass die GVK auch die Weiterentwicklung des Gleichberechtigungsartikels zum Gegenstand ihrer Beratungen machte. Denn mit der bestehenden Formulierung war zwar die formale, nicht jedoch die faktische Gleichstellung zwischen Frauen und Männern erreicht worden.
Die Debatten darüber gestalteten sich schwierig. Einig war man sich in der Kommission darin, dass Frauen weiterhin Benachteiligungen ausgesetzt seien, jedoch war man sich nicht einig darin, mit welchen Maßnahmen diese Benachteiligungen abgebaut werden sollen.
Am 27. Mai 1993 beschloss die GVK die Formulierung: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ An den Staat wird damit klar der Auftrag formuliert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gleichberechtigung der Geschlechter aktiv voranzubringen, und der Verfassungszusatz bildet für Bund, Länder und Kommunen die Rechtsgrundlage für Gleichstellungsgesetze.
Am 24. Juni 1994 trat das Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das Zweite Gleichberechtigungsgesetz (2. GleiBG), in Kraft, bei dem es sich um eine Reform des 1957 beschlossenen Gleichberechtigungsgesetzes handelt. Es beinhaltet in Artikel 1 das Gesetz zur Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bundesverwaltung und den Gerichten des Bundes bzw. Frauenfördergesetz (FFG), in Artikel 10 das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtenschutzgesetz (BSchG) und in Artikel 11 das Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Männern in Gremien im Einflussbereich des Bundes bzw. Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG).
Dieses Zweite Gleichberechtigungsgesetz von 1994 wurde 2001 durch das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes bzw. Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) abgelöst.

2005 Angela Merkel – Die erste Bundeskanzlerin
2005
Angela Merkel – Die erste Bundeskanzlerin
Nach sieben männlichen Amtsvorgängern seit 1949 wurde die CDU-Politikerin Angela Merkel (geb. 1954) am 22. November 2005 die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und übt dieses Amt bis heute aus.
Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren und wuchs in der DDR auf. Dort war sie als Physikerin wissenschaftlich tätig und promovierte 1986. 1989 trat sie in die Partei Demokratischer Aufbruch (DA) ein. Ab diesem Zeitpunkt war ihr Leben von der Politik geprägt. 1990 trat sie in die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ein und ist seit Dezember 1990 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 1991 bis 1994 war Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend, von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Von 1998 bis 2000 amtierte sie als Generalsekretärin der CDU und vom 10. April 2000 bis zum 7. Dezember 2018 war sie die Bundesvorsitzende ihrer Partei. Im ersten Halbjahr 2007 war Merkel turnusgemäß EU-Ratspräsidentin.
Nach dem knappen Sieg der Unionsparteien bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 löste Angela Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzler ab und führte eine große Koalition mit der SPD bis 2009. Nach der Bundestagswahl 2009 ging die CDU mit der FDP eine schwarz-gelbe Koalition ein, die durch eine erneute große Koalition in der Folge der Bundestagswahl 2013 abgelöst wurde. Im November 2016 gab Merkel bekannt, erneut für den CDU-Parteivorsitz sowie das Amt der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl 2017 zu kandidieren, wozu sie im Dezember vom CDU-Parteitag mit einem Ergebnis von 89,5 Prozent nominiert wurde. Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag fand am 24. September 2017 statt.
Beim internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen, dem Women20 Summit 2017 in Berlin, nahm Angela Merkel zusammen mit IWF-Chefin Christine Lagarde, der niederländischen Königin Maxima und US-Präsidententochter Ivanka Trump an einer Diskussion teil, bei der über die Möglichkeiten gesprochen wurde, die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei richtete die Moderatorin die Frage an Angela Merkel, ob sie Feministin sei. Ihre Antwort lautete, dass es dabei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gebe. Damit beschäftigten sich mehrere Zeitungsartikel, wobei auch konstatiert wurde, dass Merkel nie Politik für Frauen gemacht habe. Aber auch wenn Merkel nie offensiv dafür geworben hat, dass mehr junge Frauen in die Politik gehen, ist sie doch schon allein deshalb ein Vorbild für viele Frauen und junge Mädchen, weil sie die erste Frau ist, die Deutschland regiert.
In ihrer Rede zur Festveranstaltung ‚100 Jahre Frauenwahlrecht‘ am 12. November 2018 bezeichnete Merkel nur eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern lebt, als eine gerechte Gesellschaft. Da der Frauenanteil in den Parlamenten eine elementare Frage unserer Demokratie sei, forderte Merkel: „Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein – Parität überall.“
2005 Angela Merkel – Die erste Bundeskanzlerin
2005
Angela Merkel – Die erste Bundeskanzlerin
Nach sieben männlichen Amtsvorgängern seit 1949 wurde die CDU-Politikerin Angela Merkel (geb. 1954) am 22. November 2005 die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und übt dieses Amt bis heute aus.
Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren und wuchs in der DDR auf. Dort war sie als Physikerin wissenschaftlich tätig und promovierte 1986. 1989 trat sie in die Partei Demokratischer Aufbruch (DA) ein. Ab diesem Zeitpunkt war ihr Leben von der Politik geprägt. 1990 trat sie in die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ein und ist seit Dezember 1990 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 1991 bis 1994 war Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend, von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Von 1998 bis 2000 amtierte sie als Generalsekretärin der CDU und vom 10. April 2000 bis zum 7. Dezember 2018 war sie die Bundesvorsitzende ihrer Partei. Im ersten Halbjahr 2007 war Merkel turnusgemäß EU-Ratspräsidentin.
Nach dem knappen Sieg der Unionsparteien bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 löste Angela Merkel Gerhard Schröder als Bundeskanzler ab und führte eine große Koalition mit der SPD bis 2009. Nach der Bundestagswahl 2009 ging die CDU mit der FDP eine schwarz-gelbe Koalition ein, die durch eine erneute große Koalition in der Folge der Bundestagswahl 2013 abgelöst wurde. Im November 2016 gab Merkel bekannt, erneut für den CDU-Parteivorsitz sowie das Amt der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl 2017 zu kandidieren, wozu sie im Dezember vom CDU-Parteitag mit einem Ergebnis von 89,5 Prozent nominiert wurde. Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag fand am 24. September 2017 statt.
Beim internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen, dem Women20 Summit 2017 in Berlin, nahm Angela Merkel zusammen mit IWF-Chefin Christine Lagarde, der niederländischen Königin Maxima und US-Präsidententochter Ivanka Trump an einer Diskussion teil, bei der über die Möglichkeiten gesprochen wurde, die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei richtete die Moderatorin die Frage an Angela Merkel, ob sie Feministin sei. Ihre Antwort lautete, dass es dabei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gebe. Damit beschäftigten sich mehrere Zeitungsartikel, wobei auch konstatiert wurde, dass Merkel nie Politik für Frauen gemacht habe. Aber auch wenn Merkel nie offensiv dafür geworben hat, dass mehr junge Frauen in die Politik gehen, ist sie doch schon allein deshalb ein Vorbild für viele Frauen und junge Mädchen, weil sie die erste Frau ist, die Deutschland regiert.
In ihrer Rede zur Festveranstaltung ‚100 Jahre Frauenwahlrecht‘ am 12. November 2018 bezeichnete Merkel nur eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern lebt, als eine gerechte Gesellschaft. Da der Frauenanteil in den Parlamenten eine elementare Frage unserer Demokratie sei, forderte Merkel: „Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein – Parität überall.“
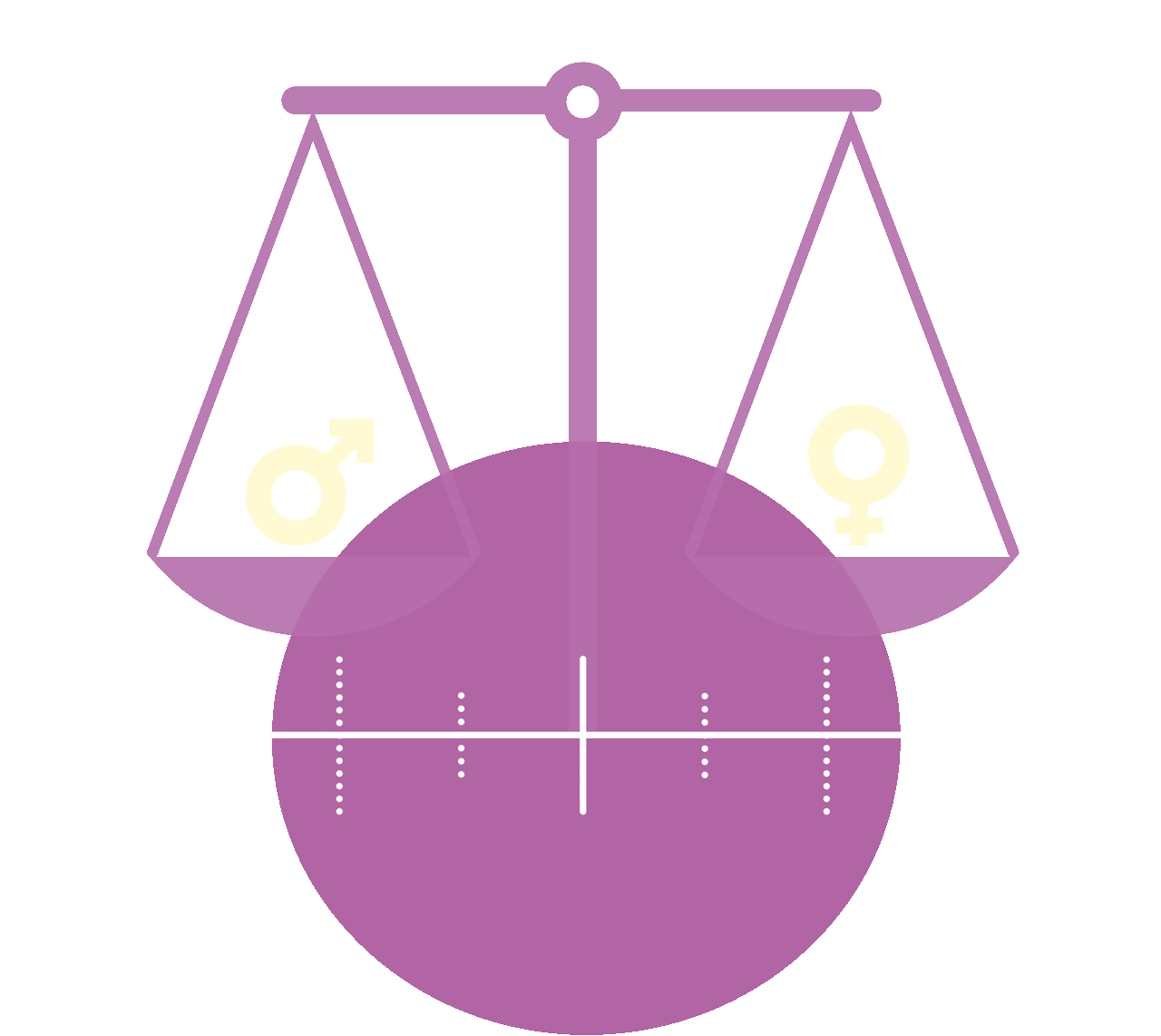
Ausblick
Zukünftige Herausforderungen
Mit Blick auf die vergangenen 100 Jahre seit Einführung des Frauenwahlrechts lässt sich feststellen, dass wir heute rechtliche Gleichstellung in Deutschland erreicht haben. Aber trotz aller Fortschritte, die aus der Frauenbewegung und der Gleichstellungspolitik resultieren, sind traditionelle Geschlechterstereotype und Verhaltensmuster weiterhin wirksam, fehlen Frauen heute besonders in Entscheidungs- und Führungspositionen, ist in der Politik der Frauenanteil unter den Parteimitgliedern oder den Mandatsträgern in den Entscheidungsgremien noch lange nicht paritätisch. 100 Jahre Frauenwahlrecht – das ist ein Grund zu feiern! Aber auch ein Grund, weitere Entwicklungen einzufordern! Frauen sind heute zwar gleichberechtigt, aber noch immer nicht mit Männern gleichgestellt.
Deshalb sind weitere Anstrengungen hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern nötig. Dazu brauchen wir Frauen, die sich engagieren, z.B. indem sie wählen gehen, aber auch, indem sie sich selbst zur Wahl stellen.
Mit 37,1 Prozent besaß der letzte Bundestag seinen bisher höchsten Frauenanteil. 2017 wurde der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Ihm gehören nur noch 218 Frauen an. Damit liegt der Frauenanteil bei 30,7 Prozent und ist 6,4 Prozent niedriger als in der vorausgegangenen Legislaturperiode. Auf kommunalpolitischer Ebene sieht das Bild nicht anders aus. In den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten z.B. liegt der Frauenanteil derzeit bei 18,7 Prozent. Tatsächlich gibt es Ortgemeinderäte, in denen keine einzige Frau sitzt. Das muss anders werden, denn jede und jeder kann dazu beitragen, dass Geschlechtergerechtigkeit Wirklichkeit wird. Und die ist dann erreicht, wenn Frauen und Männer chancengleich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Was vor einhundert Jahren erkämpft wurde – das Frauenwahlrecht – gilt es heute wertzuschätzen und zu bewahren.
Gleichstellungist unter anderem dann erreicht, wenn Frauen und Männer:
- in gleichem Maße das gesellschaftliche Leben in seinen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Facetten prägen,
- gleichberechtigt und selbstbestimmt in allen Belangen und Phasen ihres Lebens leben,
- ihren eigenen Lebensunterhalt und eine armutsfeste Alterssicherung, gestützt auf gute Aus- und Weiterbildung, gleiche Entlohnung sowie gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt erwirtschaften,
- sich gleichberechtigt Familien- und Fürsorgearbeit in Haushalt, Kindererziehung und Pflege unter Beibehaltung ihrer eigenständigen Existenzsicherung teilen,
- gleichberechtigt an den Ressourcen des Landes partizipieren,
- sicher, gewaltfrei und ohne sexistische Diskriminierungen im privaten wie im öffentlichen Raum leben,
- sich frei in ihrer Persönlichkeit entfalten und in ihrer Vielfalt wahrgenommen und geachtet werden.
Aus den Leitsätzen zur Gleichstellung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration u. Frauen, Berlin
Was vor 100 Jahren erkämpft wurde – das Frauenwahlrecht – gilt es heute zu bewahren
und fortzuführen, indem Frauen wählen und sich wählen lassen – und dadurch mitentscheiden und mitbestimmen.
